Kapitel 31: Die Aktivistin — Jänner 1896
Geachtet und geschmäht. Nie zuvor geriet Lina in solch heftige emotionale Turbulenzen wie im Jahr 1896. Trotz des Erfolgs ihrer Zeitung musste die 66–Jährige den Eindruck haben, dass angestrebte Veränderungen nur in kleinsten Schritten vorankamen. Frauen waren nach wie vor weder im Parlament noch in der Regierung vertreten, durften nicht wählen und hatten keinen freien Zugang zu Universitäten. Einmal mehr wurde Lina klar: Die Anliegen der Frauen mussten sichtbarer werden.
Zwar hatte Lina weitere Auszeichnungen und Medaillen erhalten, auf der Brüsseler Weltausstellung wurde ihr der »Fortschrittspreis« und eine Anerkennung für ihr literarisches Werk (Fußnote 1) vom Comité executiv du Grand Concours international des Science et de l'Industrie zugesprochen (Fußnote 2), ja sogar im Amtlichen Bericht über die Weltausstellung in Chicago 1893 wurde Lina Morgenstern lobend erwähnt. Trotzdem hatte sie den Eindruck, man wolle sie eher »wegloben«.
Schon im Januar hatte Lina erfahren,
dass die Behörden in Berlin–Treptow eine spektakuläre Gewerbeausstellung
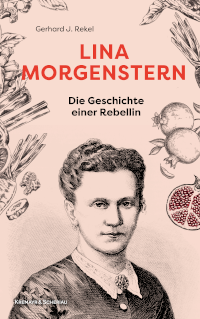 ab Mai 1896 veranstalten würden. Die Lage Berlins, nahezu im Zentrum Europas,
begünstigte aufgrund besser werdender Eisenbahnverbindungen ein Zusammentreffen
von Menschen aus vielen Ländern. Warum nicht — wie in Chicago —
einen
Internationalen Frauenkongress an die Gewerbeausstellung anschließen? Auf
deutschem Boden hatte es ein solches Stelldichein noch nie gegeben. Eine
Veranstaltung, die in Wahrheit eine Demonstration für die Rechte der Frauen
sein könnte. Vielschichtig, aufsehenerregend, provozierend. Für die Presse
nicht zu ignorieren. Ein Aufschrei. Auch international!
ab Mai 1896 veranstalten würden. Die Lage Berlins, nahezu im Zentrum Europas,
begünstigte aufgrund besser werdender Eisenbahnverbindungen ein Zusammentreffen
von Menschen aus vielen Ländern. Warum nicht — wie in Chicago —
einen
Internationalen Frauenkongress an die Gewerbeausstellung anschließen? Auf
deutschem Boden hatte es ein solches Stelldichein noch nie gegeben. Eine
Veranstaltung, die in Wahrheit eine Demonstration für die Rechte der Frauen
sein könnte. Vielschichtig, aufsehenerregend, provozierend. Für die Presse
nicht zu ignorieren. Ein Aufschrei. Auch international!
Die deutschen Frauen könnten damit der Öffentlichkeit vorführen, dass die USA, die Schweiz und andere Länder den Frauen bereits deutlich mehr Rechte zugestanden hatten. Anbieten würde sich für einen Internationalen Frauenkongress der September, dann hätte Lina noch ausreichend Vorlauf für die Organisation.
Am Montag, den 13. Januar 1896 lud sie vierzehn Mitstreiterinnen zu sich nach Hause in die Beletage. Ein konspiratives Treffen. Vor den Fenstern schwere Plüschvorhänge, beim Eintreten der Besucherinnen knarrten die Eichenholzpaneele, die Gäste nahmen auf abgewetzten, grünen Samtstühlen Platz. Daneben Linas überbordender Schreibtisch, auf den Regalen stapelten sich Bücher und Manuskripte.
Lina konnte eine Reihe bekannter Frauen für das Organisationskomitee gewinnen, darunter die 54–jährige Rosalie Schoenflies, die im Russischen Reich die erste Mädchengewerbeschule eröffnet hatte und sich bereit erklärte, die Programmkommission zu leiten. Sowie Dr. Käthe Schirrmacher, eine der ersten Frauen mit Doktortitel. Dazu kamen führende Persönlichkeiten der bürgerlichen Frauenbewegung, wie die Schriftstellerin Hedwig Dohm, die dritte in Deutschland praktizierende Ärztin Dr. Agnes Bluhm, die erste deutsche Juristin Marie Raschke, die Journalistin Eliza Ichenhaeuser sowie Linas umtriebige Freundin Maria Gubitz. (Fußnote 3) Eine große Hilfe stellte Schulrätin Minna Cauer dar; die Lehrerin und Journalistin galt als eine der ambitioniertesten Verfechterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung.
Bei Kaffee und Kuchen präsentierte Lina ihre Idee. (Fußnote 4) Sie schlug vor, den Kongress vom 19. bis zum 27. September zu veranstalten und Vertreterinnen aller »zivilisierten Länder« einzuladen. (Fußnote 5)
Einige Kolleginnen waren sofort begeistert, andere warnten: Wer würde die vielen Besucherinnen betreuen? Wo sollten die Kongress—Veranstaltungen stattfinden? Und am gravierendsten: Preußens Polizei— und Überwachungsapparat war eine ständige Bedrohung! Nach Paragraf 5 des gültigen Versammlungsgesetzes durften »Frauen, Schüler und Lehrlinge an politischen Versammlungen nicht teilnehmen«. (Fußnote 6)
Lina wusste: Spätestens seit 1885 existierte eine geheime Polizeiakte, eine »Acta des Königlichen Polizei–Präsidii zu Berlin betreffend dem Berliner Hausfrauenverein bzw. Theodor und Lina Morgenstern«. Die Polizisten protokollierten alle ihre Aktivitäten.
Vermutlich wäre sie längst hinter Gittern, wenn die Offiziellen nicht gewusst hätten, dass Lina mit Kaiserin Augusta eine Freundschaft gepflegt hatte und von der Monarchin mit Ehrenmedaillen bedacht wurde. Doch Augusta war 1890 gestorben. Sechs Jahre bereits musste Lina ohne diese Verbindung auskommen. Bei einem internationalen Kongress mit über tausend Besucherinnen aus der ganzen Welt sowie eindeutigen politischen Intentionen gegen die Regierung würden Ehrenmedaillen kaum schützen.
Von Kaiser Wilhelm II. konnte Lina nichts Gutes erwarten, er galt als Antisemit, hatte sich bei seinem Großvater Wilhelm I. für den berüchtigten Judenhasser Adolf Stoecker eingesetzt und regierte mit noch strengerer Hand als sein Vorgänger. (Fußnote 7) Lange Diskussionen der Frauenrunde führten zu einem Stimmungstief. Während Theodor Kaffee brachte, beobachtete er insgeheim, wie es Lina gelang, ihre Besucherinnen aus der Lethargie zu holen. Schulrätin Minna Cauer, Rosalie Schoenflies und Lina versuchten, aus dem Tohuwabohu einen Plan zu destillieren. Plötzlich flottierten die Gedanken, sprangen von einem Aspekt zum nächsten, kreisten um dieses und jenes. Lina lud persönlich und via Presse nahezu alle Frauenverbände ein sowie »diejenigen Männer, welche an Frauenwerken mitarbeiten« — denn sie war überzeugt, gemeinsam könnten sie den Kongress stemmen! (Fußnote 8)
Einige bürgerliche Vereine wie die Berliner Lehrerinnen vermochte Lina rasch zu begeistern, nicht jedoch die Sozialdemokratinnen. Lina informierte auch sämtliche linke Blätter, darunter zum Beispiel die österreichische Arbeiterinnen—Zeitung. (Fußnote 9) Doch ihre ausgestreckte Hand kam nicht gut an, denn die sozialdemokratische Anführerin Clara Zetkin vertrat — vermutlich von August Bebel inspiriert — die Ansicht: »Erst muss der Kapitalismus besiegt werden, dann wird sich die Frauenfrage von allein erledigen!« Diese Haltung machte eine Kooperation schwierig, zusätzlich musste sie bangen, ob die Beamten ihr tatsächlich den großen Saal des Roten Rathauses für den Kongress überlassen würden — was aber notwendig war.
Lina spürte den allgemeinen Druck — und konnte keine Minute sicher sein, ob ihr Plan tatsächlich aufgehen würde.
Fußnoten
- Chronik aus dem Frauenleben, Berlin, Band 17, Ausgabe 32, 10.08.1890, Seite 358 – 359 (Zurück)
- Kölnische Zeitung, Erste Abend—Ausgabe, Nr. 329 — Zweites Blatt, 26.11.1888, »Weltausstellung Brüssel« — Fortschrittspreise (Zurück)
- Eliza Ichenhaeuser: Lina Morgenstern — Zum hundertjährigen Geburtstage einer erfolgreichen Breslauerin. Artikel im Preußischen Geheimarchiv, GSTA PK, VII, HA, B42, Sammlung Steiniger, Nr. 1438 (Zurück)
- Vorwärts, Berlin, 17.1.1896, S. 8 (Zurück)
- Deutsche Hausfrauen—Zeitung,3.1.1897, Nr. 1, S.2 (Zurück)
- Paul Lehmann: Polizei Handlexikon, Berlin 1896, S.293 (Zurück)
- C. G. John Röhl: Wilhelm II. und die deutsche Politik, München 1995, S. 205 – 210 (Zurück)
- Arbeiterinnen—Zeitung, 3.9.1896, Nr. 17, V. Jahrgang, S.6 (Zurück)
- Arbeiterinnen—Zeitung, 1892 – 1924, Sozialdemokratisches Organ für Frauen und Mädchen (Zurück)